Big Data? Na klar, meine Excel-Datei ist schon 15 MB groß!
Big Data hier, Big Data da. Jeder spricht darüber, es ist das ganz große Ding, das keiner verpassen will. Keine Konferenz zum Thema Digitalisierung ohne nicht wenigstens einen Vortrag im Zusammenhang mit Big Data. Auch im speditionellen Umfeld geistert das griffige Schlagwort herum und man hat das Gefühl: Alle arbeiten entweder schon daran, etwas damit zu machen, oder setzen es in irgendeiner Form bereits ein. An dieser Stelle möchte ich Sie zwar nicht desillusionieren, aber ich sage es mal so: Nur weil Ihre Exceldatei 15 Megabyte groß ist, nutzen Sie noch lange nicht Big Data. Spoiler Alarm: Wahrscheinlich brauchen Sie es in den nächsten Jahren nicht einmal.

Big Data als Blackbox
Aber fangen wir einmal vorne an. Big Data wird häufig als Sammelbegriff für viele weitere Trends benutzt, die durchaus damit kombinierbar sind, aber nicht dasselbe meinen. Künstliche Intelligenz (KI) gehört zum Beispiel dazu. Sie kann dabei helfen, die Big-Data aufzubereiten, zu analysieren, schließlich zu interpretieren und auf dieser Grundlage bestimmte Probleme lösen. Sie hilft bei ergebnisoffenen Analysen, wie zum Beispiel Prognosen. Aber dazu brauchen Sie zunächst einmal jene großen Datenmengen. Und das sind überwiegend unstrukturierte Massendaten, die sozusagen wie durch einen Trichter in eine Blackbox laufen. Das beste Beispiel dafür, wo solche Informationen anfallen, sind soziale Medien. Nehmen wir zum Beispiel Twitter: Auf der Plattform posten User pro Tag etwa 500 Millionen Tweets. Diese haben zwar einen Zeitstempel und sind eindeutig Benutzern zuzuordnen. Aber diese Datenmenge strukturiert auszuwerten – zum Beispiel, um bestimmte Trends oder Stimmungen erkennen zu wollen – ist eine enorme Herausforderung. Hashtags helfen ein wenig dabei, aber sie kommen längst nicht in allen Tweets vor. Hier geht es darum, Millionen und Milliarden von Datensätzen schnell zu analysieren.
Excel: Nur die Größe zählt?
Kaum mit dem speditionellen Umfeld zu vergleichen, richtig? Große Stückgutkooperationen bewegen pro Tag vielleicht 20.000 bis 40.000 Sendungen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Datensätze fallen also längst nicht unter Big Data. Aber nicht nur aufgrund der Menge von Informationen, sondern auch wegen ihrer Struktur. Denn als Logistiker sammeln sie so gut wie keine unstrukturierten Massendaten. Sie haben genaue Informationen über Verlader, Empfänger, Zustelltermine, Kapazitäten, Mengen und so weiter. Weil diese Daten so gut strukturiert sind, nutzen vor allem mittelständische Logistiker nach wie vor relationale Datenbanken, die mit Tabellen funktionieren. Und damit sind wir auch schon bei den nach wie vor unglaublich beliebten Excel-Dateien, die gerade bei mittelständischen Speditionen das Maß aller Dinge sind. Generell kann man sagen: Je größer die Exceldatei, desto besser fühlen sich alle Beteiligten. „Wow, meine Excel ist schon 15 MB groß, nicht schlecht!“ Da stecken fraglos viele Daten drin, aber mit Big Data hat das ungefähr so viel gemeinsam wie eine Diskette mit den Anforderungen der Digitalisierung im 21. Jahrhundert.
Excel ist außerdem recht begrenzt. Nicht nur, dass die Software nicht mehr als 1,04 Millionen Zeilen verwalten kann. Hinzu kommt, dass selbst das schon eine reichlich theoretische Größe ist. Denn lange bevor Sie an diese Grenze stoßen, wird die Datei auf eine derartige Größe angeschwollen sein, dass Sie sie kaum noch vernünftig bearbeiten und auswerten können. Spätestens bei Dateien von 100 MB ist dann endgültig Schluss, ganz egal, wie leistungsfähig Ihr Computer ist. Und auch mit der besten Tabellenkalkulation lässt sich dank Formeln und Funktionen nur ermitteln, was ist. Prognosen sind damit nicht möglich.

BI statt BD!
Fassen wir also zusammen: Per Definition passt Big Data im Moment noch nicht so recht in die Speditionswelt, weil es dabei um (teilweise unstrukturierte) Massendaten geht. Speditionen hingegen sammeln und verarbeiten zahlreiche strukturierte Daten, die sich auch im Jahre 2020 noch in einem überschaubaren Rahmen bewegen. Und weil im Mittelstand nach wie vor häufig genug noch Excel zur Auswertung benutzt wird und die Datenmengen auch in Zukunft nicht auf hunderte Millionen oder gar Milliarden Datensätze pro Tag anschwellen werden, wird Big Data auch in einigen Jahren für die insgesamt mittelständisch geprägte Branche keine große Rolle spielen. Was hingegen tatsächlich statt BD wichtiger wird, ist BI – Business Intelligence.
Intelligente, automatisierte und schnell verfügbare Auswertungen sind das zentrale Thema jeder Spedition. Die Basis dafür bilden moderne relationale Datenbanken wie SQL, die tatsächlich auf die stetig steigenden Mengen an strukturierten Daten ausgelegt sind. Jede klassische BI-Lösung fußt auf einer solchen Datenbank, die zudem auch ohne künstliche Intelligenz fähig ist, Prognosen zu erstellen. Auch wenn damit zum Beispiel im Hinblick auf Mengenschwankungen keine absolute Planungssicherheit möglich ist, kann man sich doch zumindest annähern. Aber auch das beste Prognosemodell wäre an Sonderfällen wie der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie gescheitert.

Big Data ist also nicht gleichbedeutend mit much Data, Prognosen bereiten nicht auf jede Eventualität vor und eine KI ersetzt keine BI. Für Speditionen sind die klassischen, historischen Auswertungen noch immer das Beste, weil sie so exakte Ergebnisse auf eindeutige Abfragen liefern. Business Intelligence macht es möglich. Wenn es also um die Zukunft der Speditionen geht, ist der nächste Schritt erst einmal der, von Excel zu einer echten Business Intelligence zu wechseln. Erst danach lohnt sich ein Blick in die Glaskugel.

 Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay
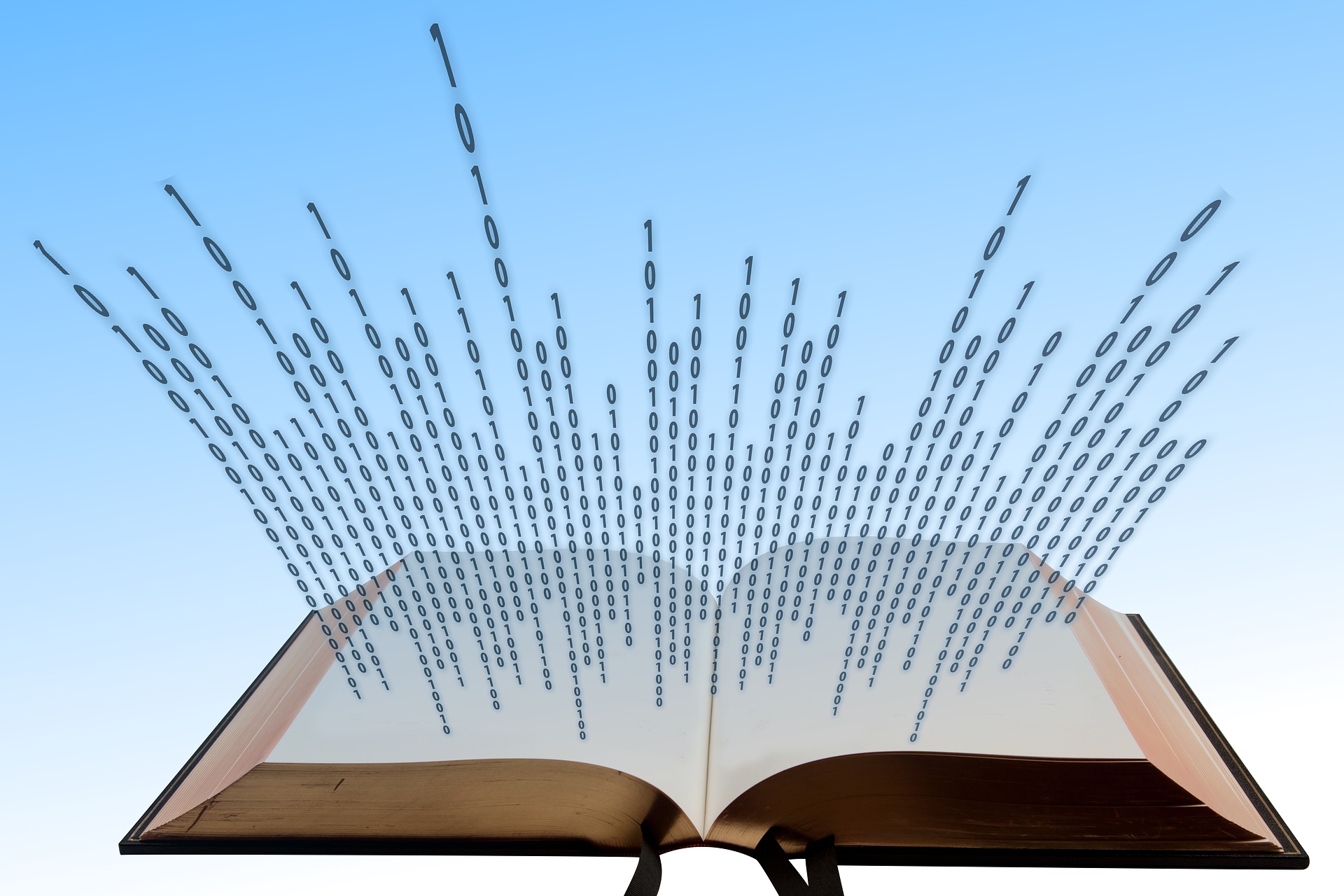

 Pixabay
Pixabay







