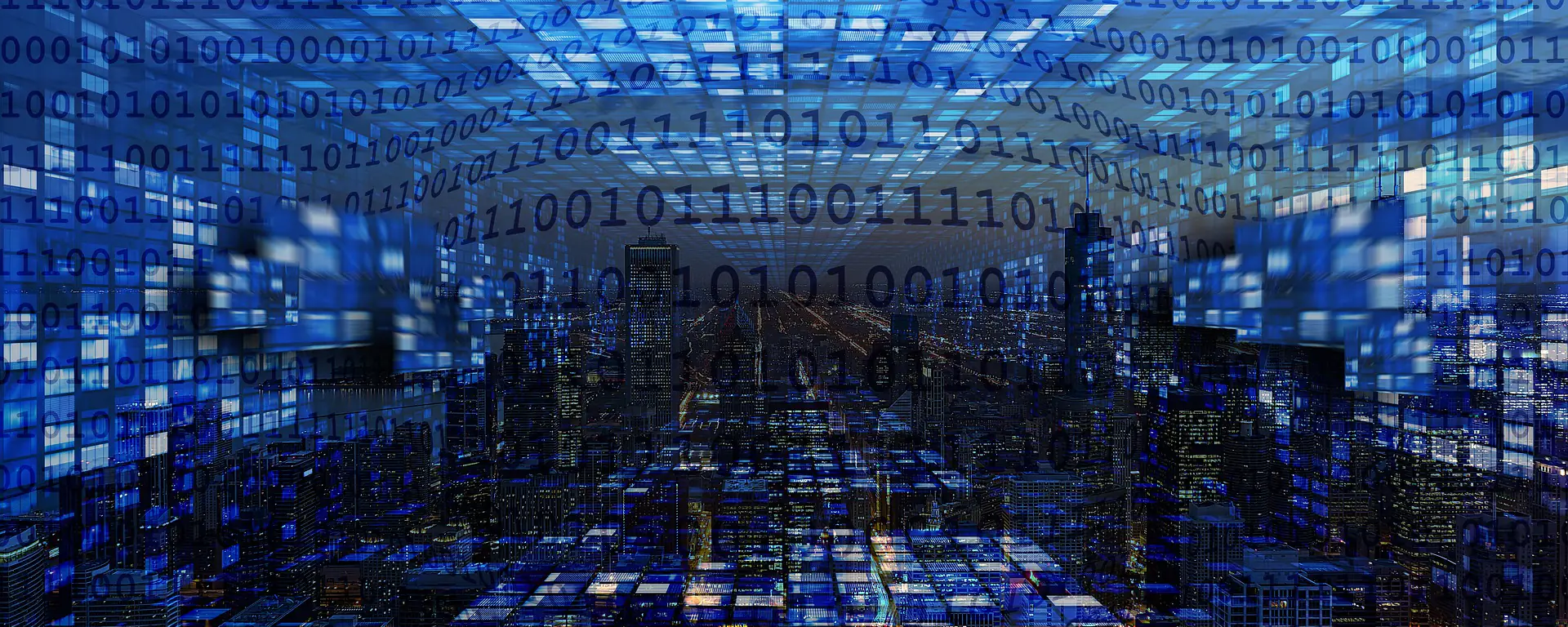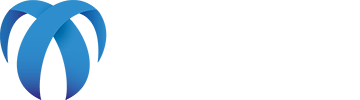Liquidität optimieren mit automatischen Abrechnungen
„Zeit ist Geld“ wusste schon Benjamin Franklin, der diesen Ratschlag jungen Kaufleuten 1748 in einem Buch mit auf den Weg gab. Bis heute hat sich daran nichts geändert, denn wer hat schon Zeit zu verschenken? Ganz ketzerisch möchte ich manchmal allerdings antworten: Logistiker! Zum Beispiel, wenn es um das Thema Abrechnungen geht. Denn die sind nach wie vor mit viel manuellem Aufwand verbunden, der Zeit und damit Geld kostet, obwohl das nicht nötig wäre. Dafür müsste nur von Anfang an korrekt gearbeitet werden. Stattdessen wird an dieser Stelle jedoch noch häufig nach dem Motto verfahren: „Hauptsache, der Auftrag ist erstmal angelegt, die Details kommen dann in der Abrechnung.“ Die Folge sind aufwendige Prüfungen der Auftragsdaten. Die Abrechner checken nahezu jeden Auftrag manuell und fragen im Zweifelsfall in der Disposition, in der Abfertigung und sogar auf der Halle nach. Das kostet reichlich Zeit. Dann darf es auch niemanden überraschen, wenn es im letzten Schritt nicht rund läuft: Leistungen, die im Vorfeld nicht sorgfältig und vollständig benannt wurden, sollen jetzt auf wundersame Weise korrekt abgerechnet werden? Wer’s glaubt … Statt dass die Rechnung am Ende der Leistungserbringung automatisch erstellt wird, braucht es auf diese Weise noch einmal viele Handgriffe, prüfende Blicke und damit vergleichsweise viel Zeit, bis Rechnungen überhaupt erstellt werden und endlich auf die Reise gehen können.

Fehler vermeiden, die Liquiditäts-Lücke so schnell wie möglich schließen
Wenn dann das Geld ja wenigstens schnell auf dem Konto wäre. Gemäß der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) wären Rechnungen ohne Zahlungsziel sofort fällig, doch Logistiker wissen: Am Ende setzen gerade große Unternehmen Zahlungsziele bis zu 60 Tagen an, in einigen Fällen sogar 90 Tage. Zwischenzeitlich zahlt der Logistikdienstleister Lieferanten und Mitarbeitende quasi in Vorleistung. Das führt zu einer Liquiditäts-Lücke von der Produktion des Transports bis zur Abrechnung. Umso wichtiger ist es doch, keine unnötige Zeit zu verschenken! An den Zahlungszielen lässt sich schwerlich rütteln, wohl aber an den manuellen Abrechnungen.
Sie sind, abgesehen vom Faktor Zeit bei ihrer Erstellung, nach althergebrachter Vorgehensweise zudem auch eine große potenzielle Fehlerquelle. Werden Gewicht und Sperrigkeit beispielsweise nicht von Anfang an korrekt berücksichtigt, fehlen sie später in der manuellen Abrechnung und gehen damit de facto „aufs Haus“ – dem Logistiker gehen direkte Einnahmen verloren. Der Kunde wird derartige Versäumnisse wohl nicht reklamieren – ganz im Gegensatz zu Fehlern zu seinen Ungunsten. In solchen Fällen erfordert die Reklamation zusätzliche Bearbeitungszeit und eine Korrektur der Rechnung. Dadurch verschiebt sich wiederum das Rechnungsdatum, an dem sich die Kunden dann wiederum beim Zahlungsziel orientieren. Das wird in den Fällen besonders heftig, in denen beispielsweise Sammelrechnungen mit mehreren Dutzend Aufträgen betroffen sind. Die komplette Rechnung bleibt dann in der Rechnungsprüfung beim Kunden stecken und wird erst dann zur Zahlung freigegeben, wenn alle Korrekturen in Belegform vorliegen – selbst, wenn nur ein kleiner Teil der Aufträge fehlerhaft war. Währenddessen tickt die Uhr beim Logistiker, die ohnehin bereits kleine Marge wird immer kleiner oder verschwindet sogar ganz. Je präziser und schneller eine Rechnung also erstellt werden kann, desto schneller ist mit dem Zahlungseingang zu rechnen und das hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Liquidität des Logistikdienstleisters. Automatische Abrechnungen sind also keine Kür, sondern Pflicht!

Unternehmerisches Harakiri ohne automatische Abrechnung
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: Es gleicht einem unternehmerischen Harakiri, nicht automatisiert abzurechnen. Sie haben keine Zeit zu verschenken, tun aber genau das beim Thema Abrechnungen – und nehmen damit in Kauf, am Ende im ungünstigsten Fall noch draufzuzahlen. Sicher, so mancher Logistiker vertraut auf die langjährige Erfahrung seiner Abrechner, die einen Großteil der Bestandskunden kennen und darauf, dass es meist eben schon gut gehen wird. Und die Mitarbeiter mögen sich vielleicht auch nicht unbedingt umstellen wollen, fürchten vielleicht sogar um ihren Job, obwohl sie in den allermeisten Fällen mit Sicherheit wichtigere Aufgaben im Unternehmen wahrnehmen könnten. Aber wie lange wird das noch gut gehen? Wie viele Jahre trennen die tief eingearbeiteten Fachkräfte noch von der Pensionierung? Und wie steht es dann um die Nachwuchskräfte? Die guten und qualifizierten Arbeitskräfte zu Datenbereinigungen und als Klickroboter bei der Auftragsbewertung einzusetzen, erscheint mir eine fragwürdige Beschäftigung zu sein. Junge Mitarbeiter für diese monotone Aufgabe zu begeistern, wird unmöglich werden. Besonders dann, wenn eine Software bessere Resultate liefert.
Die automatische Abrechnung macht also aus wirtschaftlichen und personalpolitischen Erwägungen Sinn. Dabei genügen für Speditionen zwei wesentliche Dinge, um in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorne zu machen: Wie für alle automatischen Prozessschritte braucht es eine sehr gute Datenqualität und ein Transport Management System, das automatisierte Abrechnungen zuverlässig ermöglicht, einschließlich Sonderleistungen. Die allermeisten Aufträge können und müssen einfach durchlaufen. Dann liegen Leistungsdatum und Faktura-Datum nahe beieinander. Das spart Zeit, senkt die Fehlerquote erheblich und führt damit zu weniger Rechnungsbeanstandungen und folglich zu einer verbesserten Liquidität.

Automatisierung in der Abrechnung ist kein Hexenwerk
Umstellung ist kein Hexenwerk
Automatische Abrechnungen erfordern einen einmaligen Aufwand für die technische Umstellung. Da ist es gut zu wissen, dass anwenderorientierte Importfunktionen den Wechsel zusätzlich erleichtern: So lassen sich in der CargoSuite beispielsweise Tarife ganz einfach aus einer Excel-Datei importieren. Das System erkennt in vielen Fällen die vorhandene Matrix und überführt diese ins neue System. Auch komplexe Regelwerke lassen sich abbilden und automatisiert definieren. So lassen sich zum Beispiel für jeden Kunden individuelle Frachtpflichtigkeitsregeln pro Ladungsträger, Lade- oder Kubikmeter einstellen oder auch Zusammenfassungsregeln für Aufträge erstellen, die in den gleichen Tarif laufen sollen. Wer also vielleicht meint, eine automatische Abrechnung könne die komplexen Regelwerke nicht ohne weiteres berücksichtigen, irrt sich gewaltig.
Wer also weiterhin Zeit und Geld verschenken will, dem empfehle ich die Lektüre des Klassikers von Benjamin Franklin. Vielleicht überzeugt ihn das ja. Wer nach vorne schauen, seine Spedition zukunftssicher aufstellen und dabei auch noch seine Liquidität verbessern will, der sollte dringend auf automatische Abrechnungen setzen. Darin steckt viel Potenzial, schneller an sein Geld zu kommen. Einer der wesentlichen Schlüssel dazu ist, wie so oft in Digitalisierungsprozessen, eine hohe Datenqualität. Sprich: Stammdaten und Vertragsakten müssen sauber angelegt werden. Die Zeit ist es in jedem Fall wert – und das rechnet sich am Ende.

 Pixabay
Pixabay Anaxco/KI-generiert
Anaxco/KI-generiert

 ANAXCO/KI-generated
ANAXCO/KI-generated
 istock
istock


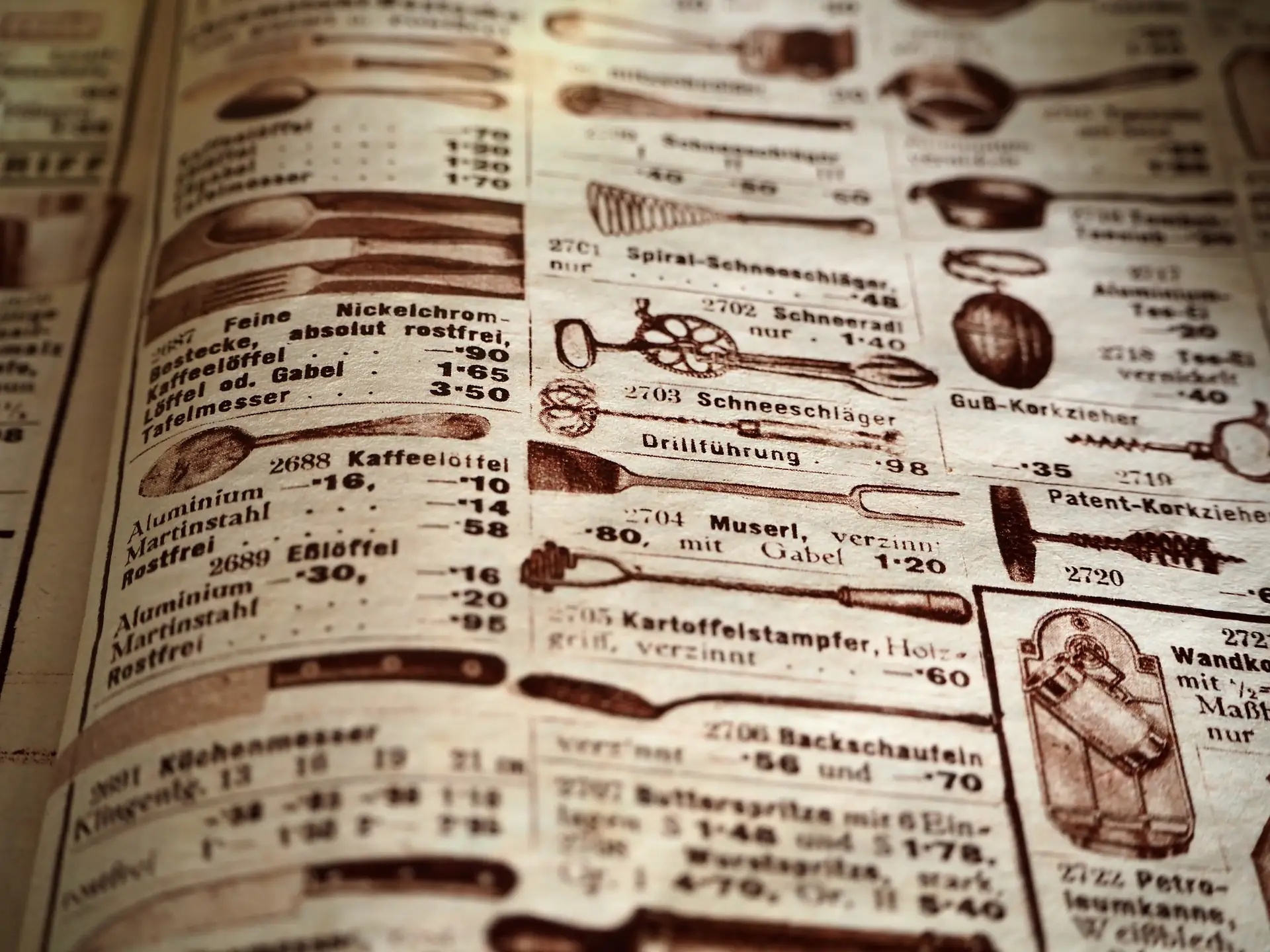 Pixabay
Pixabay


 iStock
iStock

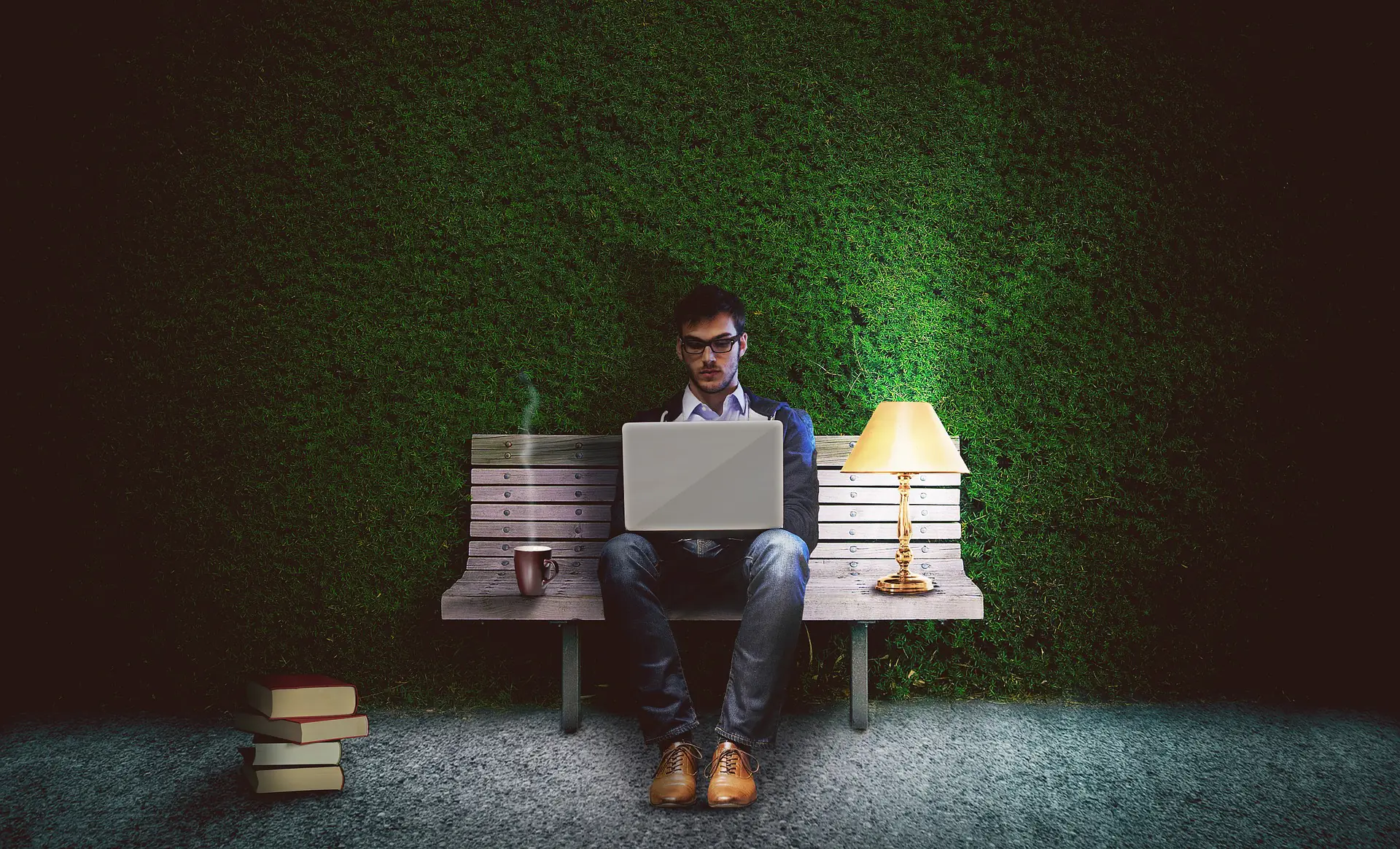 Pixabay
Pixabay
 Andreas Schmid Group
Andreas Schmid Group
 iStok
iStok