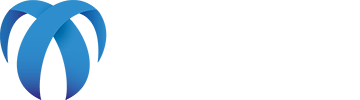Starkes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit: Dunning-Kruger-Effekt
Der Klügere gibt nach, heißt es sprichwörtlich. Wenn das allerdings alle Klugen stets beherzigen würden, wäre das fatal. Zum Glück ist es nicht immer so, dass die weniger Wissenden den Ton angeben. Trotzdem steckt mehr als nur ein Funke Wahrheit in dem alten Sprichwort. Denn vermutlich haben wir alle schon einmal erlebt, dass ausgerechnet diejenigen, die sich und ihre Fähigkeiten stark überschätzen, sich mitunter besonders selbstsicher und laut auf die eigene Schulter klopfen. Sie wissen dies und kennen jenes schon, können zu allem etwas beitragen und selbst ausgewiesene Experten noch mit Halbwissen kleinreden.
Inkompetenz trifft Selbstüberschätzung
Immerhin sagte schon Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Aber dazu gehörte damals wie heute die Fähigkeit der Selbstreflexion. Wem es daran ganz entschieden mangelt und wer sich gleichzeitig für den großen Zampano hält, bei dem spricht man im Englischen von der „Superiority Illusion“. Die Psychologen David Dunning und Justin Kruger führten dazu 1999 eine Untersuchung an der US-amerikanischen Cornell University durch. Dabei ging es um die kognitive Selbsteinschätzung der Studenten. Das Ergebnis der Studie: Inkompetente Menschen sehen sich häufig nicht als solche, sondern überschätzen ihr eigenes Können regelmäßig. Gleichzeitig verwehren sie sich durch ihre Ignoranz einen echten Erkenntnisgewinn und verschließen die Augen vor kompetenteren Zeitgenossen. Diese merkwürdige Melange aus mangelnder Selbsterkenntnis, Ignoranz und überhöhter Selbstsicherheit wird seither auch als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet.
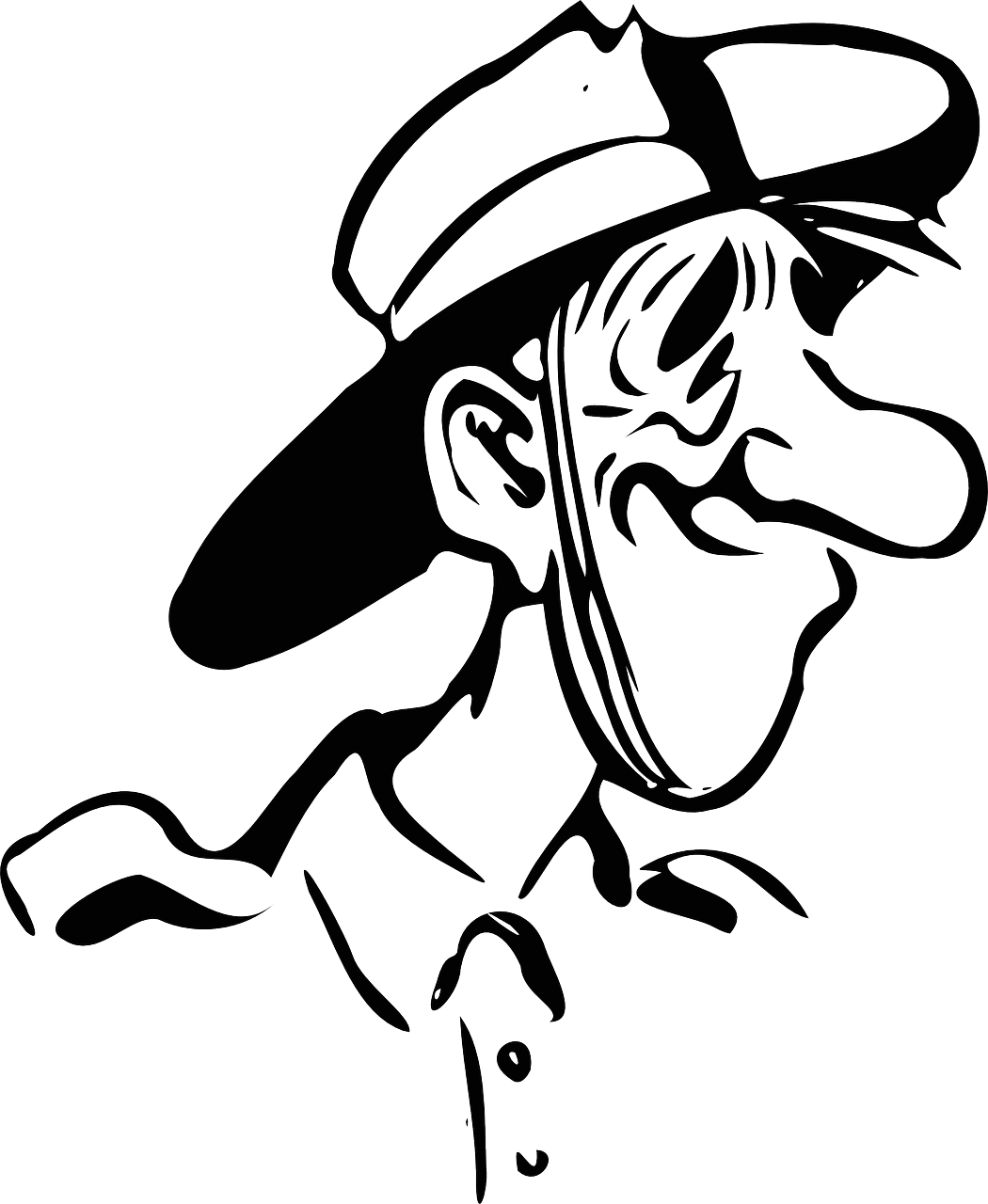
Dunning-Kruger-Effekt in Unternehmen
Auch in Unternehmen soll es gelegentlich vorkommen, dass Vertreter dieser Art in Schlüsselpositionen auftreten. Wenn beispielsweise Entscheidungsträger einen Bereich verantworten, der zwar unter ihre Befugnis, nicht aber in ihren Kompetenzbereich fällt. Die besonders hohe Selbstsicherheit gepaart mit einem autoritären Stil ersticken rasch jede noch so berechtigte Kritik an einem einmal entschiedenen Vorgehen im Keim. Geht etwas schief, suchen die Vertreter des Dunning-Kruger-Effekts dann gerne die Schuld bei anderen oder äußeren Einflüssen – denn an der eigenen Unfehlbarkeit besteht ja gar kein Zweifel. Und die Chance, dass dem Unternehmen durch dieses Verhalten Aufträge entgehen oder zumindest ein Imageschaden entsteht, ist hoch. Darüber hinaus verprellt dieses Verhalten fähige Kolleginnen und Kollegen, die im schlimmsten Fall das Unternehmen verlassen.
Vorbeugende Maßnahmen
Und was lässt sich da machen? Gibt es da nicht was von Ratiopharm? Leider nicht. Aber wer sich diese Punkte immer wieder bewusst macht, ist schon ein gutes Stück weiter:
- Konstruktives Feedback einfordern
Gute Ideen entstehen in einem Kopf, aber reifen erst dadurch, dass man sie mit anderen teilt. Fordern Sie darum immer konstruktive Kritik ein und erreichen damit nebenbei, dass sich ein ganzes Team verantwortlich für das Gelingen eines Projekts fühlt, weil es an dessen Entstehung beteiligt ist. - Selbstkritisch bleiben
Niemand hat die Antwort auf alle Fragen, auch Experten nicht. Denken Sie an Sokrates. Darum bleiben Sie sich und ihren Fähigkeiten gegenüber zu einem gewissen Grad kritisch und machen Sie sich klar, dass es niemanden gibt, der nichts mehr dazulernen muss. - Neugierig und offen bleiben
„Argumentiere, als hättest du recht und höre zu, als würdest du falsch liegen“, lautet ein prägnantes Zitat des amerikanischen Organisationspsychologen Karl Weick. Den Argumenten des Gegenübers zuzuhören, sie gedanklich zu durchdringen und dann sachlich zu bewerten ist für die Erweiterung des eigenen Horizontes wichtig.
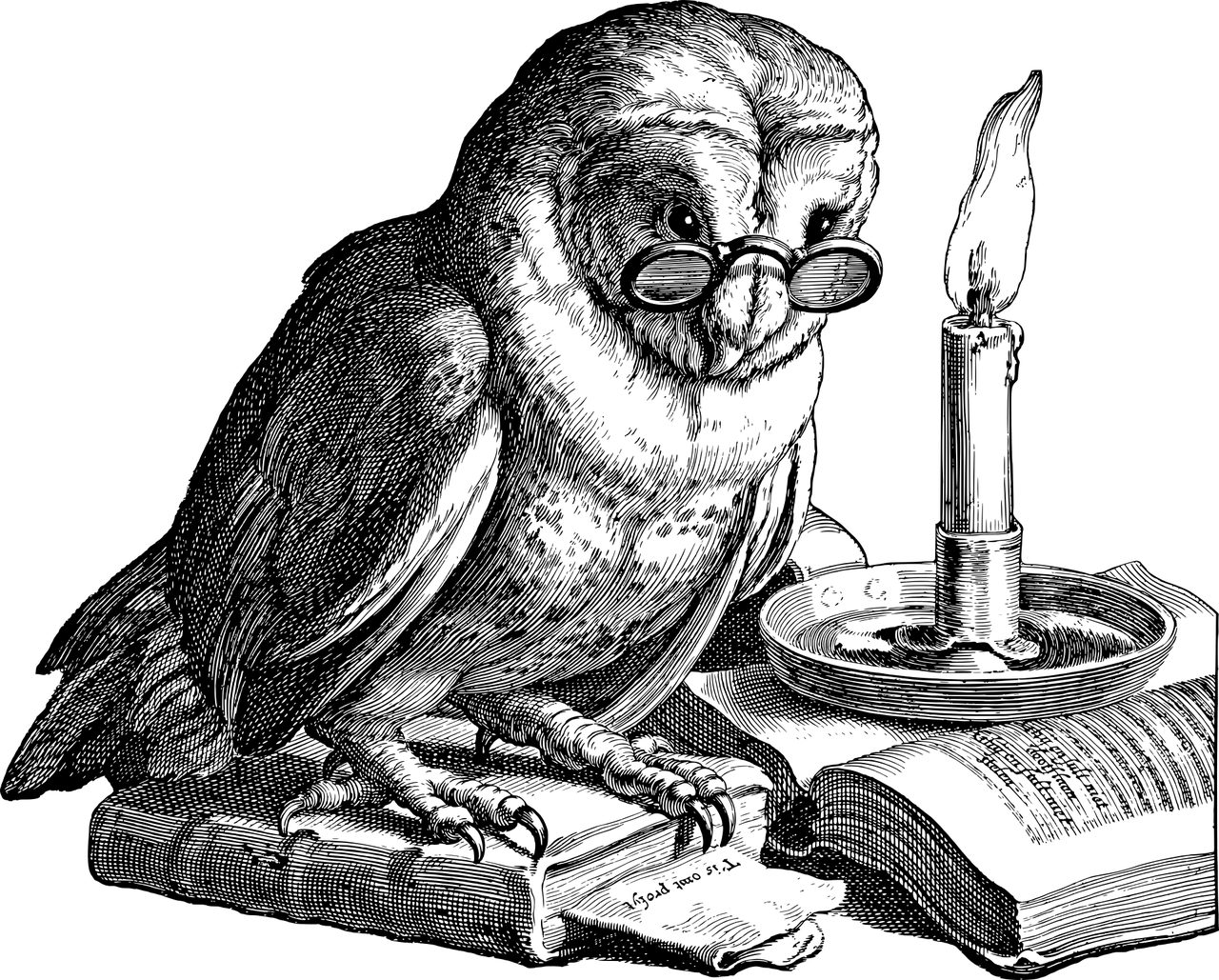
Der vielleicht schwierigste Teil: Wer einem Dunning-Kruger-Vertreter begegnet, sollte sachlich und beharrlich darlegen, welche Gründe beispielsweise für ein anderes Vorgehen sprechen. Die Argumentation darf sich nicht gegen die Person richten, sondern sollte stets im Sinne des bestmöglichen Outcomes für das Unternehmen erklärt werden. Es kann hilfreich sein, wenn weitere Kolleginnen und Kollegen die Argumente stützen. Denn wenn die Klügeren immer nachgeben – wem ist dann am Ende geholfen?

 Pixabay
Pixabay Pixabay
Pixabay


 Pixabay
Pixabay


 Pixabay
Pixabay

 Pixabay
Pixabay








 Pixabay
Pixabay
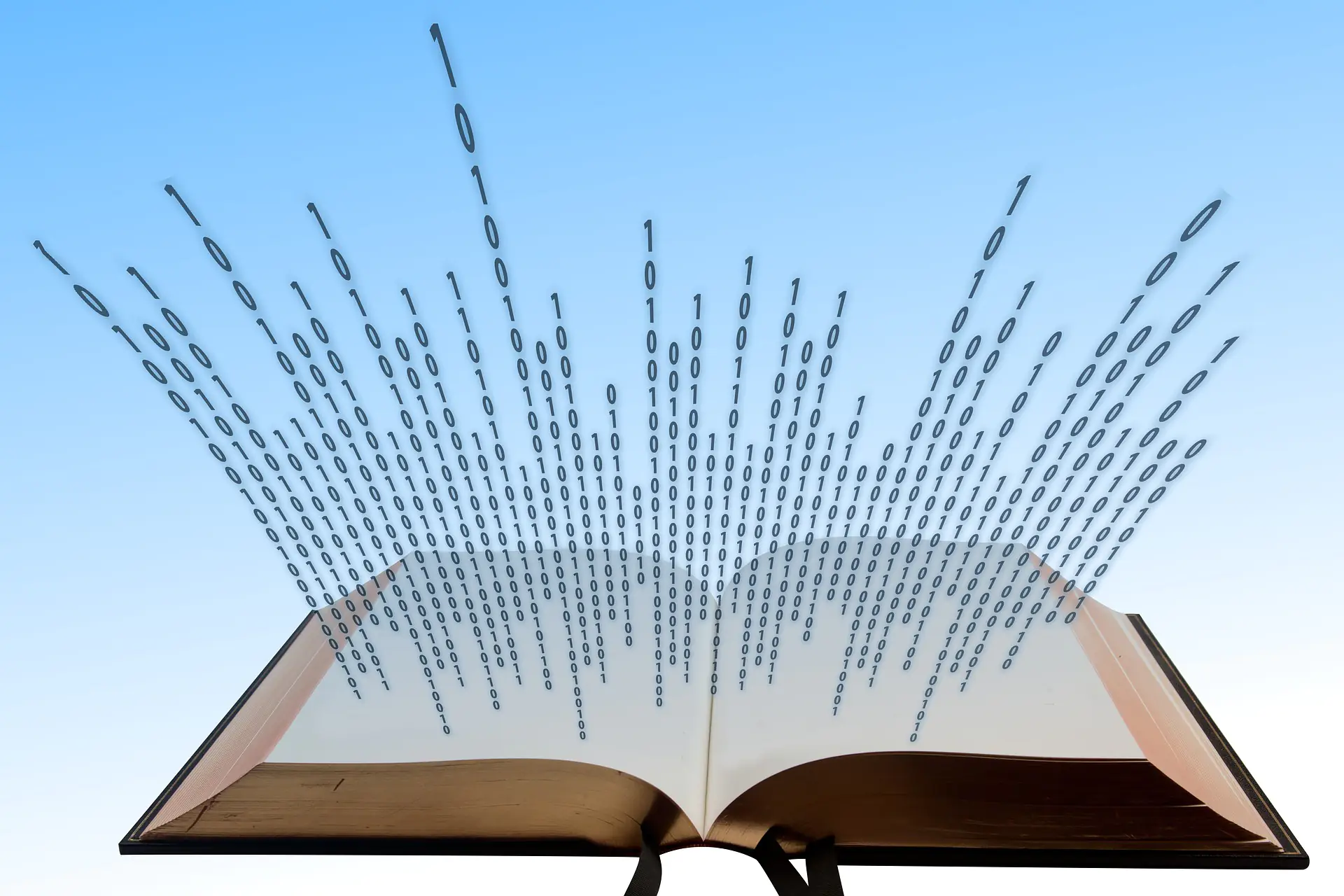

 Pixabay
Pixabay






 Der Slogan „Daten sind das neue Öl“ klingt zwar erst einmal einleuchtend, ist aber letztlich denkbar unpassend. Natürlich sind sie im Informationszeitalter praktisch allgegenwärtig. Es sollte vielmehr darum gehen, wie wir Daten sinnvoll und rechtlich einwandfrei nutzen und welche Werkzeuge wir dafür einsetzen. Wie wir uns besser vernetzen. Wie wir sie im B2B-Umfeld austauschen und wie alle Beteiligten davon profitieren können. Und vor allem ist das richtige Know-how entscheidend, um mit Daten Wertschöpfung zu betreiben.
Der Slogan „Daten sind das neue Öl“ klingt zwar erst einmal einleuchtend, ist aber letztlich denkbar unpassend. Natürlich sind sie im Informationszeitalter praktisch allgegenwärtig. Es sollte vielmehr darum gehen, wie wir Daten sinnvoll und rechtlich einwandfrei nutzen und welche Werkzeuge wir dafür einsetzen. Wie wir uns besser vernetzen. Wie wir sie im B2B-Umfeld austauschen und wie alle Beteiligten davon profitieren können. Und vor allem ist das richtige Know-how entscheidend, um mit Daten Wertschöpfung zu betreiben.